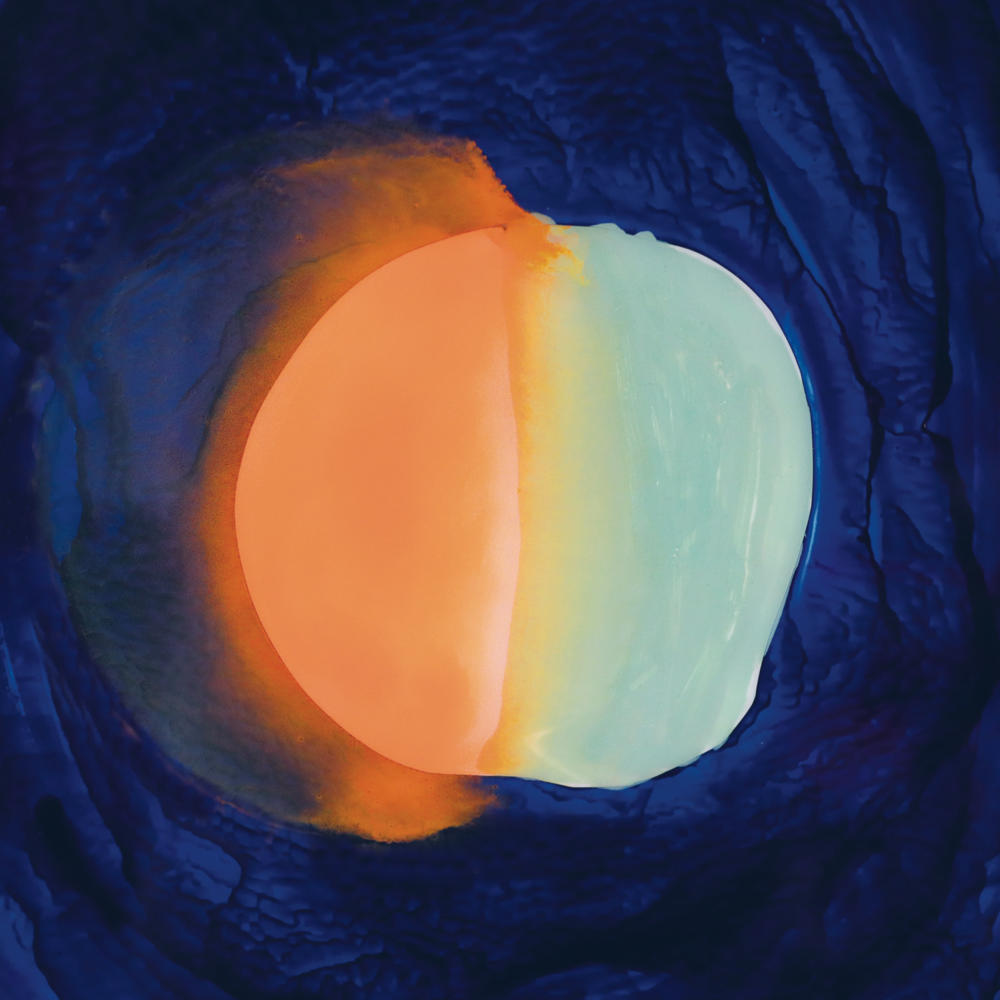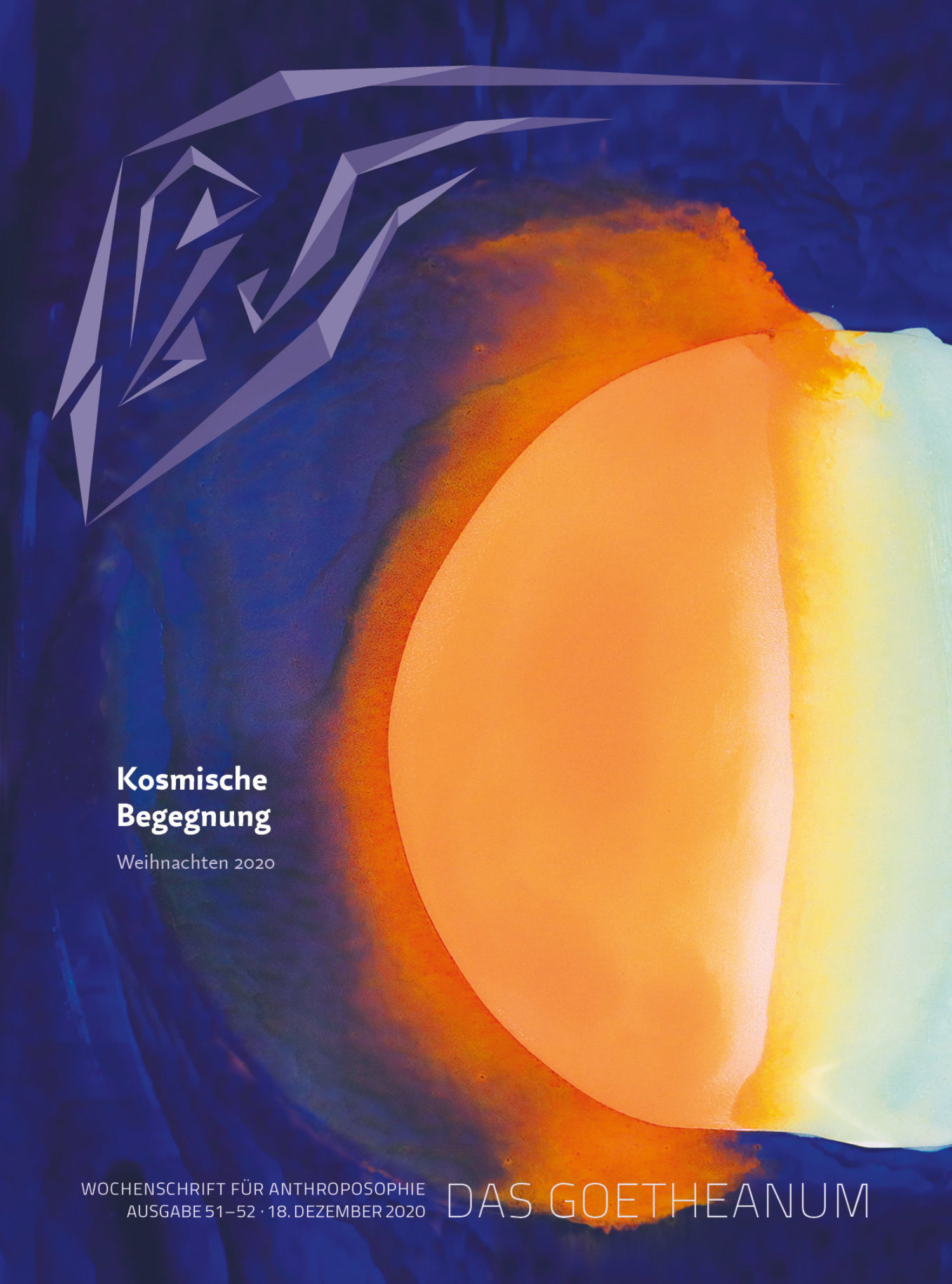Die Große Konjunktion: Ein Ruf des kosmischen Ich
Am Tag der Wintersonnenwende vereinen sich Jupiter und Saturn zu einem Doppelgestirn, wie zuletzt vor 20 Jahren. Wolfgang Held schreibt in der letzten Wochenschrift des Jahres 2020 über diese besondere Konstellation.
«Es gibt nichts, was ich mit größerer Genauigkeit zu erforschen und so sehr zu wissen verlangte als dies: Kann ich wohl Gott, den ich bei der Betrachtung des Weltalls geradezu mit Händen greife, auch in mir selbst finden?» Johannes Kepler1.
Welch ein Gegensatz: Mit Pandemie, Klimawandel und Erosion demokratischer Kultur lässt sich kaum sagen, wie die nächsten Monate sein werden. Und oben am Himmel vollzieht sich das Schauspiel von Jupiter und Saturn, wie vor zehn, ja hundert Jahren vorausgerechnet. Als vor 20 Jahren, im Mai 2000, Jupiter und Saturn zuletzt in Konjunktion standen, war dies wegen der nahen Sonne nicht beobachtbar. Dann wusste ich: In 20 Jahren, da kannst du am westlichen Abendhimmel die Konjunktion verfolgen. Doch nur auf den ersten Blick steht die himmlische Ordnung im Gegensatz zum irdischen Treiben, denn beide Ereignisse beleuchten sich, erklären sich gegenseitig. 30 Jahre beschäftige ich mich mit dem Lauf der Planeten und der Frage, wo und wie diese Lichtwelt, diese «Aktion des Kosmos», wie Novalis es in seinen Fragmenten nennt, sich über das Auge hinaus in der irdischen Welt spiegelt. Die Antwort liegt im Lauf der Planeten selbst, wenn man das Näher und Weiter, Heller und Dunkler beobachtet, dem Lichtklang von Planet und Tierkreisbild folgt. Und sie liegt in dem, was auf der Erde geschieht. Gespräche mit Sterninteressierten – zuletzt mit Dorian Schmidt – haben mich in der Einschätzung bestärkt, dass man den Gehalt einer Konstellation nicht weit voraussagen kann. So wie manches auf Erden, um es zu beurteilen, räumliche Nähe braucht, so gilt dem Himmel gegenüber zeitliche Nähe. Erst wenn sich herausstellt, in welche soziale Wirklichkeit eine Himmelskonstellation fällt, auf welche Fragen und Bewegungen sie trifft, beginnt die besondere Stellung der Planeten zu sprechen.
Wer viel über diese Frage des Unten und Oben nachgedacht hat, wer neu versucht hat, das ägyptische «Wie unten, so oben» zu buchstabieren, ist der Astronom und Astrologe Johannes Kepler. Er war beides, Sterndenker und Sterndeuter und konnte mit kühlem und warmem Blick zugleich auf den Lauf der Planeten schauen, konnte die Gesetze der Umlaufzeiten entdecken und zugleich treffsicher Horoskope erstellen, wie dasjenige für den späteren Feldherrn Wallenstein, als dieser noch ein unbekannter Diener am Hof in Wien war. Kepler lehnte dennoch das meiste des damaligen astrologischen Wissens und Glaubens ab, allerdings nicht die Stellung der Planeten, ihre Winkel, «wie sich die Planeten untereinander anblicken». Kepler glaubte an die Wirkung auf die «sublunarische Natur, auf die Gesamtheit aller Wesen unterhalb des Mondes, «wan die liechtstralen zwyer Planten hier auf Erden einen gefüegen Winkel machen.» Die gefügen Winkel sind die harmonischen Proportionen, Konjunktion, Quadratur, Opposition. Dabei werde die Wirkung nicht von den Planeten und deren Lichtstrahlen verursacht, sondern dadurch, dass die beseelte sublunarische Natur durch ihren ihr eingeborenen geometrischen Instinkt dieser harmonischen Verhältnisse innewird und dadurch eine Erregung erfährt, sodass die Wesen das, wozu sie geschaffen sind, so Kepler, mit größerem Eifer und Tätigkeitsdrang verrichten würden². Es gebe also eine innere Musikalität, die durch die Planetenstellungen angeregt werde.
Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Website der Wochenschrift lesen.
Das Goetheanum · Ausgabe 51-52 · 18. Dezember 2020