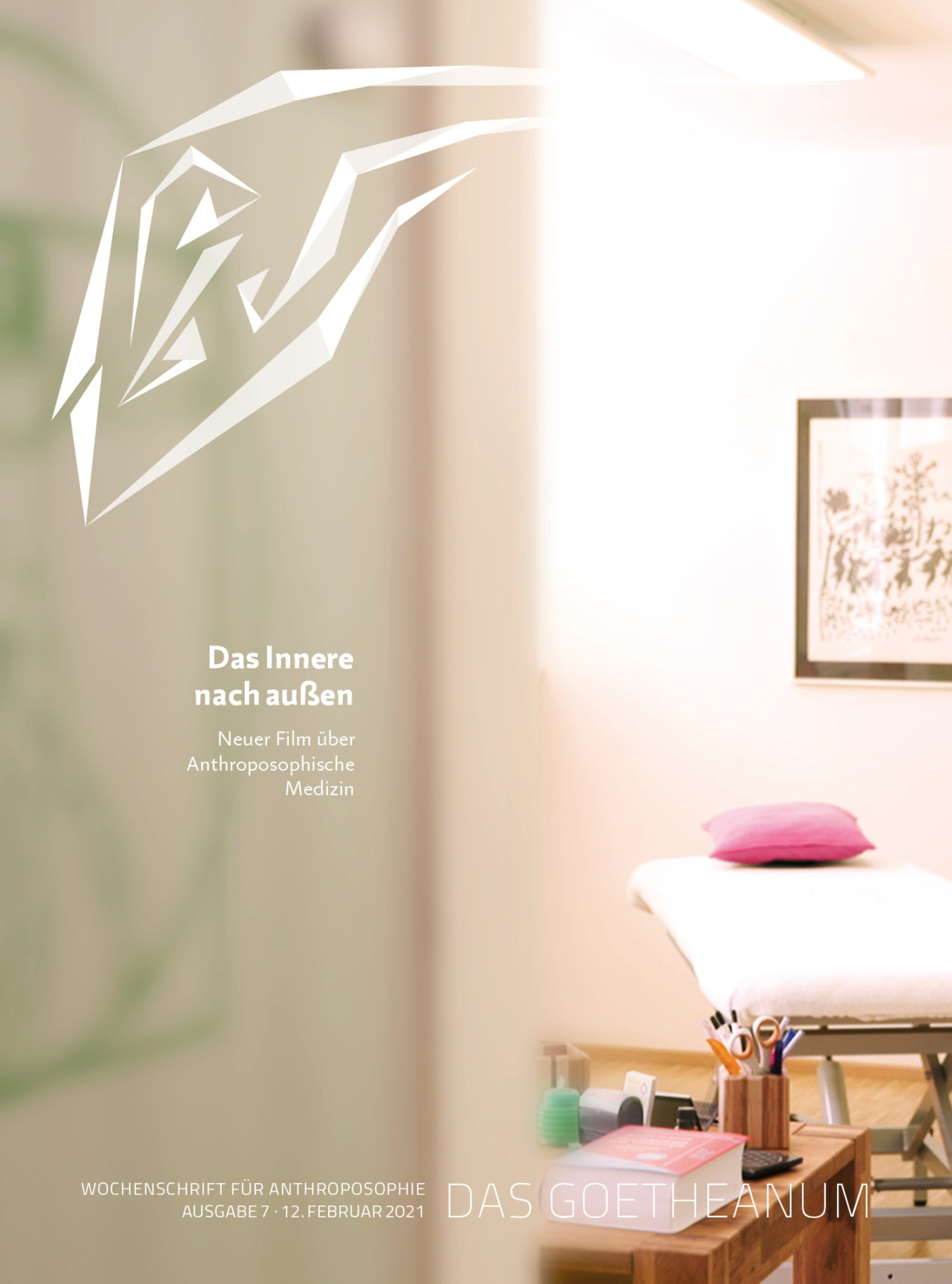Die Kunst des Heilens
Wolfgang Held sprach im ‹Goetheanum› mit Matthias Girke und Georg Soldner über die neue Filmreihe ‹Die Kunst des Heilens›. Die Filmreihe vermittelt in sieben Folgen ein vielseitiges Bild der anthroposophische Medizin. Es entsteht ein Porträt einer modernen und zukunftsfähigen Medizin im 21. Jahrhundert.
Ab dem 12. Februar 2021 ist der Film ‹Die Kunst des Heilens› auf der eigenen Homepage mit seinen sieben Folgen zugänglich. In den sozialen Medien ist bereits der Trailer des insgesamt eineinhalbstündigen künstlerischen Dokumentarfilms zu sehen, in dem verschiedene Protagonisten in kurzen Schnitten Anthroposophische Medizin charakterisieren: als Entwicklungsmedizin, Liebe zum Menschen, warmes Interesse, Freiheit, Heilung des ganzen Menschen, als therapeutisches Pendant zum Allradantrieb, Anregung zur Selbstentwicklung, Menschlichkeit, als Einheit von Körper, Geist und Seele, als topaktuelle Zukunftsmedizin und Pionierin der Integrativen Medizin. «Wir wollten eine geeignete öffentlichkeitsfähige Darstellung der verwirklichten Anthroposophischen Medizin, wobei deren Hintergründe durchscheinen sollten.» So beschreibt der Leiter der Medizinischen Sektion, Matthias Girke, das Motiv, diesen Dokumentarfilm zu produzieren. Man wollte keinen geschlossenen Film in Spielfilmlänge schaffen, sondern eine Abfolge kürzerer Darstellungen, die für sich stehen können und jeweils ein Arbeitsfeld der Anthroposophischen Medizin in den Fokus nehmen. Er zählt drei Felder auf, die ihn am Film beeindrucken: Der Regisseur habe eine Bildsprache gefunden, die nicht nur kognitiv Interessierte erreiche, er habe eine künstlerische Diktion und zugleich würden die Inhalte sichtbar werden, unter anderem auch mit dem klassisch anthroposophischen Medium (animierter) eingeblendeter Tafelzeichnungen. In einfacher Bildsprache soll so, was zur Anthroposophischen Medizin inhaltlich zu sagen ist, verständlich werden.
Das Zusammenspiel der Wesensglieder – filmisch
Georg Soldner erinnert daran, dass es zum 100-jährigen Jubiläum der Anthroposophischen Medizin notwendig war, eine zeitaktuelle Gesamtdarstellung Anthroposophischer Medizin zu schaffen. Gleichzeitig sei die filmische Erzählung in der heutigen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, um etwas wahrnehmen zu können. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe habe man dabei noch nicht ahnen können, dass eine solche Fülle von verzerrten und falschen Bildern über die Anthroposophische Medizin wie gegenwärtig kursieren würden. Umso froher seien Matthias Girke und er, dass jetzt dieser Film der Öffentlichkeit vorgestellt werden könne. Der Regisseur Benedikt Schulte, der u. a. den auf Arte ausgestrahlten Film ‹Die Seele der Geige› gedreht hat, hat als Dokumentarfilmer schon Erfahrungen mit Anthroposophischer Medizin gesammelt durch zwei Videodokumentationen zu Rhythmischen Einreibungen und zur Öldispersionsbad-Therapie. Im Laufe des Drehs sei dem Filmer dann immer deutlicher aufgefallen, so Soldner, wie groß die Diskrepanz sei zwischen dem, was Anthroposophische Medizin ausmache, und dem, was in der medialen Öffentlichkeit lebe.
Dabei sei es nicht einfach, gegenüber diesen Zerrbildern ein Bild zu schaffen, das authentisch wirke und nicht plakativ sei und doch überzeuge. So habe am Anfang die Frage gestanden, wie der Film in der Art seiner Komposition und Bildgestaltung etwas von den Anliegen und Überzeugungen der Anthroposophischen Medizin und auch der Anthroposophie zeigen könne. Wie der Filmemacher diese Frage beantwortet hat, ist so überraschend wie einleuchtend: Die einzelnen Filmsequenzen beginnen jeweils mit einer Probe des Stuttgarter Kammerorchesters mit seinem Dirigenten Thomas Zehetmair. Was die Vorstellung des Zusammenspiels der Wesensglieder Körper, Lebensorganisation, seelische Organisation und geistige Individualität des Menschen in der Anthroposophie bedeutet, das zeigt sich filmisch ganz selbstverständlich im Miteinander der Musiker und den Hinweisen des Dirigenten. Gleichzeitig verbindet die Orchesterwerkstatt mit der in ihr sich abspielenden Steigerung die sieben einzelnen Folgen des Films. Ähnlich ist es mit den animierten Tafelzeichnungen, die ebenfalls mit geringem begrifflichem Aufwand Zusammenhänge der Anthroposophie verständlich machen. Ursprünglich sollten in eigenen Folgen die Anthroposophische Medizin in Israel, in Peru und Brasilien gezeigt werden. Das verhinderte die Coronapandemie, sodass der Film sich jetzt vorläufig auf die Länder, von denen die Anthroposophische Medizin ihren Ausgang genommen hat, also die Schweiz und Deutschland, beschränkt. 80 Prozent der Produktionskosten von etwa 100 000 Euro haben dabei anthroposophische Stiftungen finanziert, sodass nur 20 Prozent aus dem Sektionshaushalt fließen mussten. Für den Anspruch, einen Film auf dem Niveau eines TV-Films zu drehen, ist das ein knappes Budget. Von Drohnenflügen über die Kliniken und das Goetheanum bis zu intimen Einstellungen eines Arzt-Patienten-Gespräches spannen sich die Einstellungen. Zur Bildsprache, gerade bei einem ‹Geburtstagsfilm›, gehöre auch, so Matthias Girke, dass in den Interviews auch viele jüngere Menschen, Studierende und ÄrztInnen in Ausbildung zu Wort kommen und so die Jugendlichkeit und Frische dieser Medizin implizit gezeigt wird.
Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Website der Wochenschrift lesen.
Das Goetheanum · Ausgabe 7 · 12. Februar 2021
Titelbild: Still aus dem Film ‹Die Kunst des Heilens›.