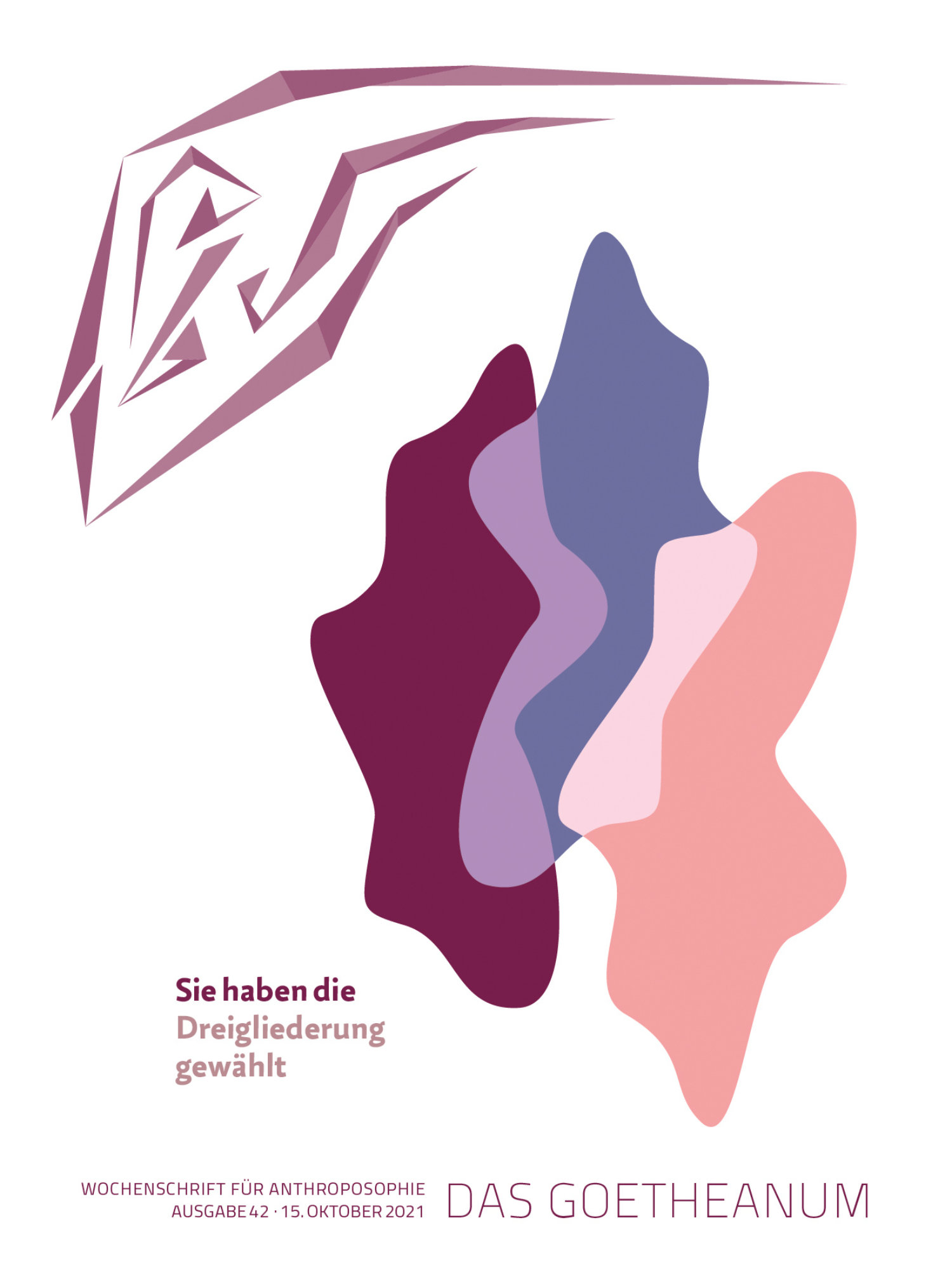Die Sinneserfahrung als Icherlebnis
Zum dritten Mal veranstaltete die Sektion für Schöne Wissenschaften Anfang September eine Tagung zu Rudolf Steiners Fragment ‹Anthroposophie›. Diesmal ging es um die Frage, was Sehen, Hören oder Riechen für das eigene Ich bedeuten. Edwin Hübner berichtete von der Tagung in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum›.
Es gibt Texte, die umso schwerer zu verstehen sind, je weiter man sie liest. Das Fragment ‹Anthroposophie› – das Buch, welches Rudolf Steiner 1909 zu schreiben begann und nicht zu Ende führen konnte – ist ein solcher Text. Gerade weil er so unzugänglich ist, ist er besonders anregend für die selbständige Auseinandersetzung mit dem darin besprochenen Thema der Sinnesnatur des Menschen.

Rudolf Steiner schrieb es, als er noch Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft war. Der Grundimpuls des Buches ist, eine mittlere Stellung zwischen der Theosophie und der zeitgenössischen Anthropologie einzunehmen. Steiner gebraucht das Bild eines Berges, um sein Anliegen zu charakterisieren. Die Theosophie stehe auf dem Gipfel des Berges und habe den großen Überblick über eine Landschaft, während die Anthropologie am Fuße des Berges durch die Landschaft gehe, dort zwar keinen weiten Überblick habe, dafür aber sehr detailliert auf die Einzelheiten der Landschaft hinschaue. Den Standpunkt, der auf der halben Höhe des Berges eingenommen werden kann, bezeichnet Rudolf Steiner 1910 als ‹Anthroposophie›. Er verbindet sie zu einer Sichtweise, die noch die Einzelheiten im Auge hat, aber doch bereits sieht, was die Details zu einem Ganzen zusammenzuschließen vermag.
Andreas Luckner knüpfte in seinem Vortrag an dieses Anliegen Steiners an und stellte es in Beziehung zu verschiedenen Strömungen der Phänomenologie, die Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt waren: Goethes Phänomenologie sowie Hegels Phänomenologie des Geistes und die in Anknüpfung an Franz Brentano von Edmund Husserl ausgearbeitete Phänomenologie, die sich weiter verzweigte und ausbreitete. Eine besondere Aufmerksamkeit legte Luckner auf Brentanos Begriff der Intentionalität.
Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Website der Wochenschrift lesen.
Titelbild: Xue Li