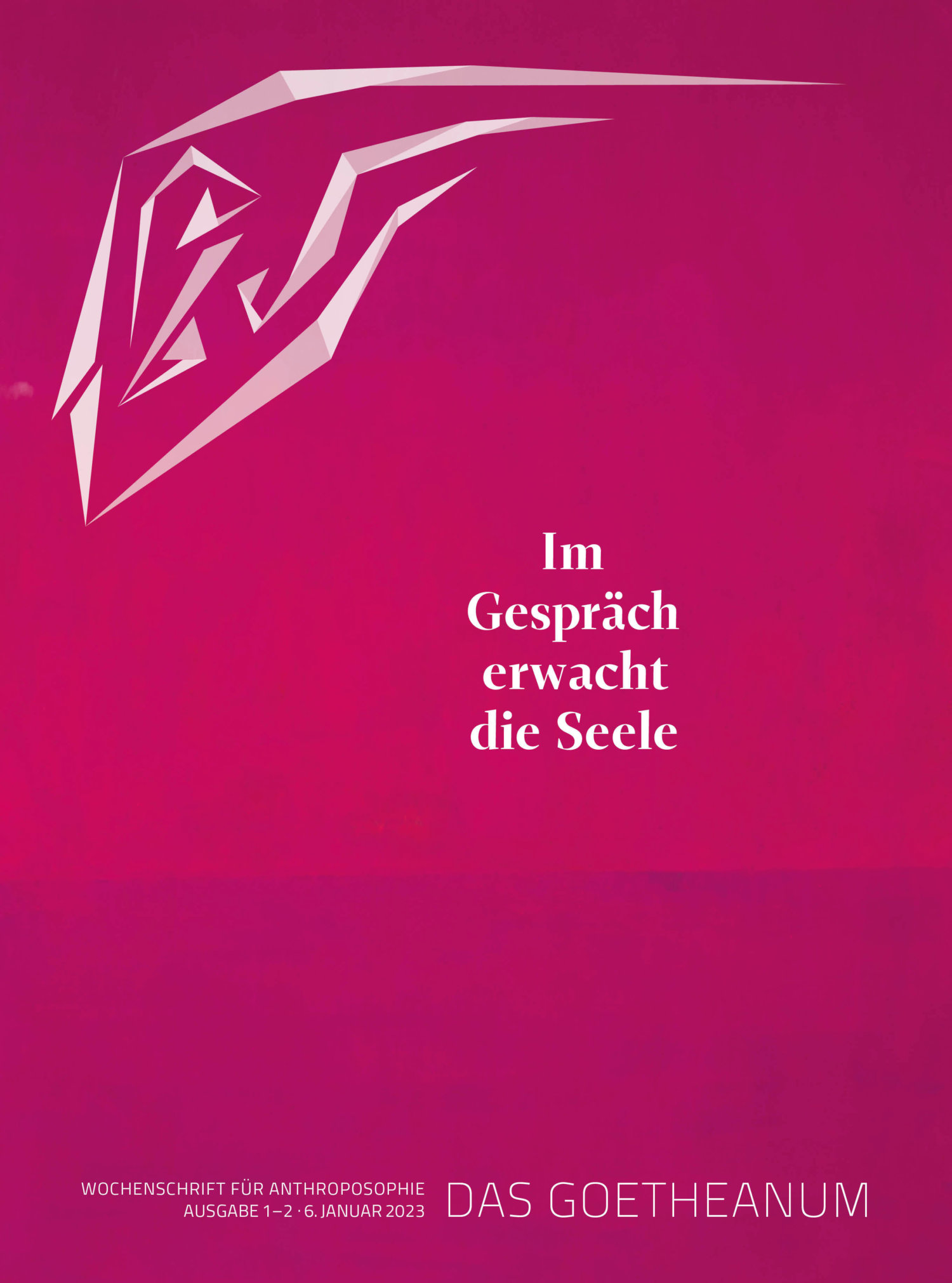Nach der Brandnacht
Der Rauch an der Brandruine des Goetheanum war kaum verflogen, da sagte Rudolf Steiner: «Und ich hoffe natürlich, dass in keiner Richtung hier irgendeine Unterbrechung eintritt.» So wurde der Brand zu einer Zäsur in der Entwicklung der Anthroposophie und nicht zu einem Hindernis.
Rudolf Steiner war von der Brandnacht gezeichnet, auch er. «Man fühlt, wenn man mit dem Bau in Liebe verbunden war, die unbarmherzigen Flammen schmerzend durch die Empfindungen dringen, die in die ruhenden Formen und in die darin versuchte Arbeit sich ergossen haben», schrieb Steiner in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum›.(1) Trotz der dramatischen Geschehnisse der gesamten Nacht und des Anblicks einer «ausgebrannten Stadt» (I. Rennefeld) ließ Steiner am Neujahrstag die unter Wasser stehende, von Ruß, Schmutz und Gestank erfüllte Schreinerei aufräumen, um am Abend den Kurs ‹Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft› fortführen zu können. «Sie können […] überzeugt sein, ich selber werde mich von meinem Wege niemals abbringen lassen, was auch geschieht. Solange ich lebe, werde ich meine Sache vertreten und werde sie in derselben Weise vertreten, wie ich sie bisher vertreten habe. Und ich hoffe natürlich, dass in keiner Richtung hier irgendeine Unterbrechung eintritt», sagte Steiner am 5. Januar 1923 zu den Arbeitern am Goetheanum.(2) Keine ‹Unterbrechung› der anthroposophischen Arbeit am Ort sollte eintreten – trotz des Infernos. Denn genau um diesen Abbruch sei es den Gegnern der Anthroposophie und des Baues gegangen.(3)
Nicht Larmoyanz und Anklage waren gefragt, sondern etwas ganz anderes. Rudolf Steiner hielt keinen Vortrag mehr, in dem er auf die aversiven Kräfte einging, sondern sprach lediglich über die Selbstverpflichtungen der Anthroposophischen Gesellschaft. Vordringlich seien der Erwerb und die Verstärkung der inneren Kraft und Klarheit – «Studieren Sie die Tragiker aller Zeiten. Sie werden sehen, es besteht die Tragik darinnen, dass alles Äußere zusammenzubrechen scheint und dass nur im Innern selber die Kraft ist, die über die Katastrophe hinausführt.»(4) Wesentlich sei das Arbeiten aus dem «Zentrum des Geistigen», unbeeindruckt von äußeren Hindernissen und Einbrüchen – und dies gerade auch dort, wo der Inhalt und das zivilisatorische Wirkanliegen der Geisteswissenschaft auf dem Spiel stehe: «Dass trotz aller Schicksalsschläge, auch trotz aller günstigen Schicksalsschläge, die innere Energie im Herausarbeiten aus dem Zentrum des Geisteslebens nicht erlahmt, davon hängt dasjenige ab, was mit der anthroposophischen Bewegung erreicht werden soll und auch erreicht werden kann.»(5) Äußerer Erfolg oder Misserfolg zähle in dieser Perspektive nicht, sondern nur dasjenige bedeute etwas, «was aus der inneren Kraft und den inneren Impulsen der Sache selbst hervorgeht.»(6)
Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Webseite der Wochenschrift lesen.
Bild Erstes Goetheanum nach dem Brand. Bildquelle: Rudolf-Steiner-Archiv.