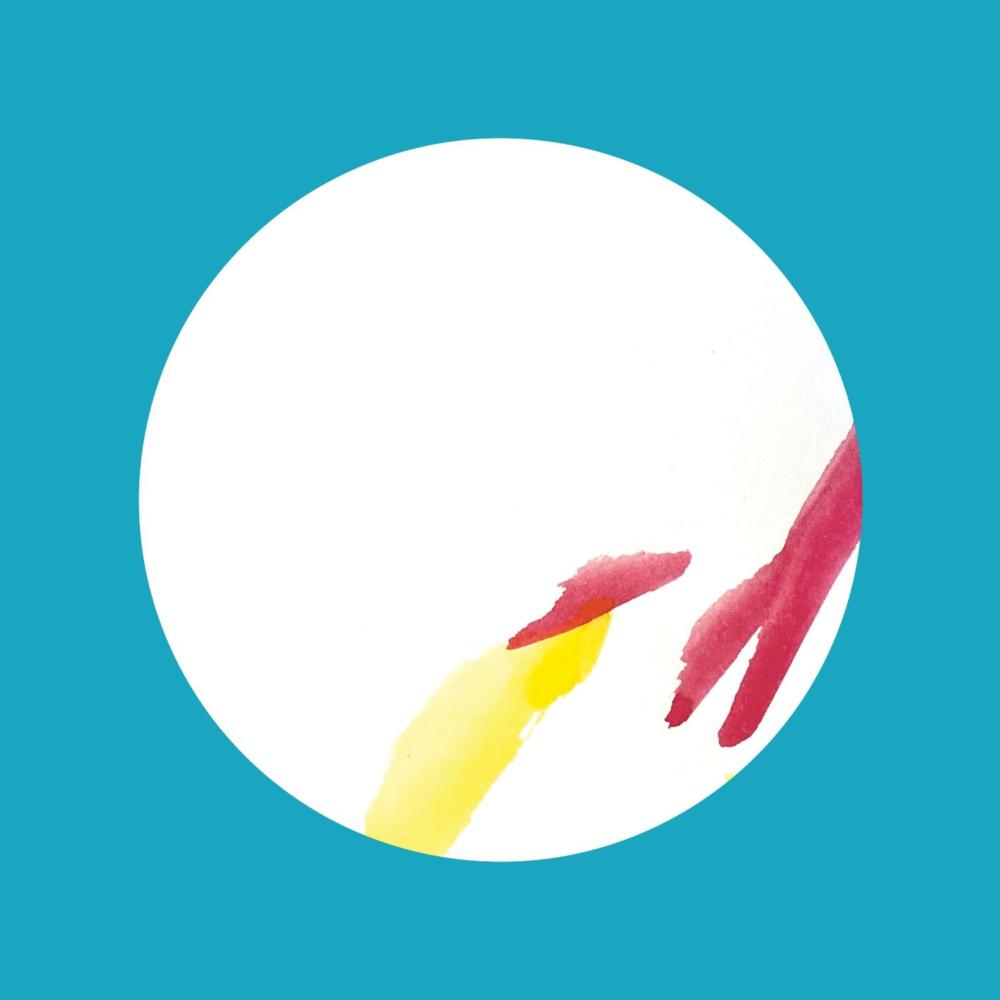Neun mal neun Partnerschaften
Führung und Partnerschaftlichkeit erschienen lange Zeit als Gegensätze. Doch die Arbeitswelt ist im Wandel. Wie solch eine Umstellung für die Mitarbeitenden der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum aussehen kann, erzählt Verena Wahl, Geschäftsführerin der Sektion für Landwirtschaft, im ‹Goetheanum›. Das Gespräch führten Franka Henn und Wolfgang Held.
Die Sektion hat in den letzten Jahren einen Organisationsentwicklungsprozess angestoßen, bei dem eure Arbeit vollständig umgekrempelt wurde und Visions- und Tatkraft in den Mittelpunkt gerückt sind. Drei Jahre hat dieser Umbau gedauert. Wie ist er entstanden?
Ich habe vor vier Jahren angefangen, hier zu arbeiten. Es war bereits im ersten Jahr klar, dass die Aufgaben, die auf die Sektion zukommen, immer mehr werden und von dem kleinen Team nicht zu schaffen sind. Die erste große Aufgabe, die ich bekam, war 2017, zusammen mit 50 Menschen der internationalen biodynamischen Bewegung nach Indien zum Organic World Congress in Delhi zu reisen. Das war das erste Mal, dass die Sektion und die internationale biodynamische Landwirtschaftsbewegung gemeinsam eine zentrale Veranstaltung außerhalb Mitteleuropas besuchten. Daraus erwuchsen noch mehr Aufgaben. Es wurde überdeutlich, dass es viel zu tun und auch Unterstützung gibt, und dass der Wunsch da ist, dass wir mehr machen. Aber bis dato gab es die beiden Sektionsleiter, eine Sekretärin und Jasmin Peschke mit je einer Teilzeitstelle. Da wurde für mich bereits klar, dass man nicht nur mehr Menschen einstellen, sondern die Arbeit strukturell verändern muss. Dafür konnte nicht mehr alle Verantwortung bei einer Spitze liegen. Ein wichtiger Faktor für uns war auch, dass beide Sektionsleiter nicht in Dornach wohnen und tatsächlich nur einmal die Woche hier sind. Es brauchte ganz einfach andere Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen, um gut arbeiten zu können.
Das heißt, es ging um eine Veränderung der Konstitution, nicht nur der Aufgabenverteilung?
Ja. Ich habe gemerkt, selbst wenn ich zwölf Stunden am Tag arbeite, bleibt immer noch die Hälfte liegen. Schon im ersten Jahr kam der Punkt, wo ich mich fühlte, als würde ich die Schule schwänzen, wenn ich um 19 Uhr Feierabend machte. Denn normalerweise arbeitete ich bis 20 oder 21 Uhr, und zwar jeden Tag. Das ist auf Dauer weder gesund noch sinnvoll. Die erste Idee war dann, das Team zu erweitern, aber alles über mich oder die Sektionsleiter laufen zu lassen. Das ist jedoch nicht die Art, wie junge Menschen heute arbeiten wollen. Meiner Erfahrung nach sind sie bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch für größere Projekte, nicht nur für einzelne Aufgaben. Dafür mussten wir umstrukturieren.
Jetzt seid ihr schon in der Durchführungsphase. Wie und zu welcher neuen Struktur seid ihr gekommen?
Es gab mehrere Phasen. Zunächst eruierten wir unsere Aufgabenbereiche. Zum Beispiel: Veranstaltungen, Kommunikation, Projektleitungen innerhalb der Sektion. Ende 2019 stellten wir fest, dass wir es grundsätzlich anders angehen müssen. So stiegen wir im vergangenen Frühling in einen Organisationsentwicklungsprozess mit Tobias Lang von der Trigon-Entwicklungsberatung ein. Er nennt sich Entwicklungsbegleiter, nicht Coach, und er sagt nicht, wie es geht, sondern begleitet uns so, wie wir veranlagt sind. Das ist ein stimmiger Ansatz für uns gewesen. Am Schluss entstand, was wir jetzt unsere ‹Partnerschaft› nennen. Wir neun Mitarbeitenden in der Sektion sind nun Partnerinnen und Partner und beraten gemeinsam. Die jeweils Betroffenen bereiten ihre Anliegen dialogisch vor, also für das ganze Team, und wir besprechen es gemeinsam.
Was heißt dialogisch vorbereiten?
Momentan zum Beispiel machen Jean-Michel Florin und Lin Bautze ein gemeinsames Projekt. Sie bereiten es vor und überlegen für sich, was aus dem Team noch dazukommen könnte. Sie sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen, aber sie stellen Fragen oder Anfragen, über die wir dann in einen Dialog kommen. Aus diesem Gespräch geht es wieder zurück an die Projektleitenden.
Das ändert völlig die pyramidale Struktur, die wir auch im Goetheanum gewöhnt sind, in der die Sektionsleitenden die schlussendliche Entscheidung haben. Ist das eine Entmachtung?
Wenn ich das beschreibe, wirkt es ein bisschen wie 1970er-‹FlowerPower›. Aber das ist es ganz sicher nicht. Wir schätzen einander sehr, aber wir sind nicht alle gleich. In unserem Prozess haben wir geklärt, was die einzelnen Funktionen sind, die über ein Projekt hinausgehen. So haben die Sektionsleiter Ueli Hurter und Jean-Michel Florin klar die Verantwortung, sich um die Vision und das Leitbild der Sektion zu kümmern. Das hat ihre Führungsrolle bestärkt und sie sind gleichzeitig in die Pflicht genommen. Die Vision ist zentral, denn Selbstverantwortung funktioniert nur, wenn wir alle in die gleiche Richtung schauen. Die Vision, die innerhalb der Leitung lebt, muss dann gemeinsam verabschiedet werden. Das ist die entscheidende Führungsaufgabe: mit dem Team einen partnerschaftlichen Visions- und Leitbildprozess durchzuführen, damit alle Teammitglieder Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel ist André Hach jetzt für ein Projekt mit einem Budget von 300 000 Franken zuständig. Seit das Budget verabschiedet wurde, entscheidet er darüber. Änderungen bis 20 000 Franken entscheide ich als Geschäftsführerin mit. Nur wenn es darüber hinausgeht, werden die Sektionsleiter einbezogen. Um so verantwortlich entscheiden zu können, brauchen wir Klarheit, wo die Sektion hinwill, und wir müssen selbst in diesem Bild drinstehen. So haben wir gleichzeitig die Rolle der Leitung gestärkt und können jetzt andererseits viel selbstverantwortlicher arbeiten.
Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Website der Wochenschrift lesen.
Das Goetheanum · Ausgabe 9 · 26. Februar 2021
Illustration: Adrien Jutard und Fabian Roschka