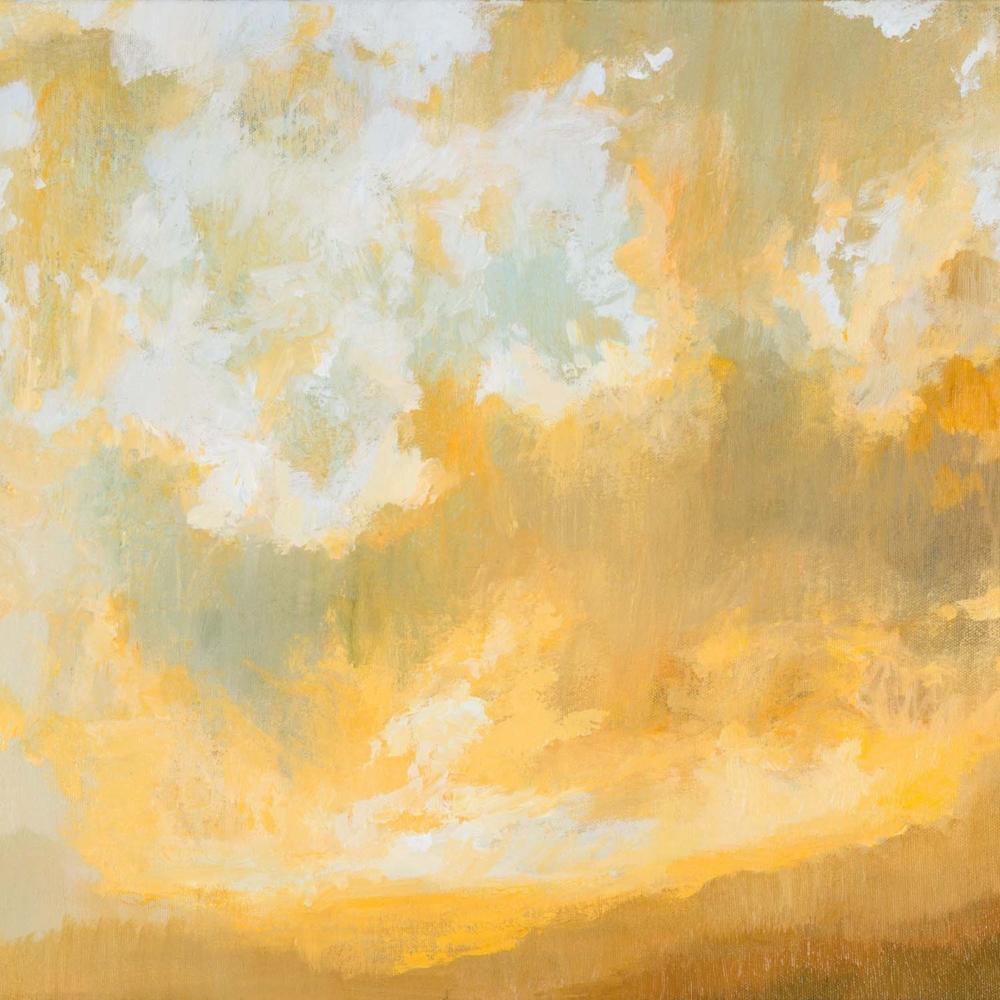Vom Morgenrot des Schönen – Eine Zukunftsutopie
In der gegenwärtigen Weltsituation über das Schöne nachzudenken, bedeutet für manche Orte auf der Welt im Moment der Zerstörung und Finsternis eine Utopie des Lichtes. Oder es bedeutet, Perspektiven für einen möglichen Weg ins Licht in den Blick zu nehmen. Das ist angesichts von Leid, Zerstörung und Tod ein Wagnis, welches Christiane Haid, Leiterin der Sektionen für Schöne Wissenschaften und Bildende Künste, eingeht. Denn die Weltsituation hängt in einer tieferen Schicht eng mit der Frage nach der Schönheit zusammen.
In der ersten seiner ‹Fünf Meditationen über die Schönheit› stellt der chinesische Dichter und Kalligraf François Cheng das Schöne und das Böse einander gegenüber. Cheng beschreibt, wie es heute eine Provokation ist, angesichts des «allgegenwärtigen Elends und der blinden Gewalt, der Naturkatastrophen und der ökologischen Desaster» über die Schönheit zu sprechen. Für ihn bilden das Schöne und das Böse daher die beiden Pole des Universums der Wirklichkeit, in der wir leben.
Goethe hat dies im dritten Akt von ‹Faust II› eindrucksvoll dargestellt, in der Gegenüberstellung von Helena, der schönsten Frau Griechenlands, für die berühmte Helden Kämpfe ausfochten, und Phorkyas, der greisen Hüterin ihres väterlichen Palastes, einer unvorstellbar hässlichen Alten, hinter der sich Mephisto verbirgt. In Phorkyas steht Helena ein Wesen gegenüber, das sowohl hässlich wie böse ist, denn die Schöne gerät durch das Böse/Hässliche in eine tödliche Bedrohung. Phorkyas kündigt ihr an, dass die Heimkunft ihres Gatten für sie tödlich enden könnte, denn der vor Eifersucht Entbrannte erwägt seine Frau den Göttern zum Opfer zu bringen. Die Begegnung mit dem absolut Hässlichen und zugleich Bösen löst in Helena einen Prozess der Selbsterkenntnis aus. Im Augenblick der größten Gefahr fragt sie sich, wer sie ist und woher sie stammt. Sie erkennt sich im Spiegel des Hässlichen in ihrer wahren Wesenheit. Schönes, Hässliches und Böses sind bei Goethe noch vermischt.
Rudolf Steiner bringt in seiner Kunstauffassung das Schöne und das Hässliche mit dem Hintergrund der von ihm entdeckten Doppelnatur des Bösen in einen Zusammenhang. Doch nicht nur das Schöne, sondern ebenso das Hässliche sind für ihn die den Kunstprozess konstituierenden Elemente: «Wollen wir Kunst wirklich fassen, so dürfen wir niemals vergessen, dass das letzte Künstlerische in der Welt das Ineinanderspielen, das Im-Kampfe-Zeigen des Schönen mit dem Hässlichen sein muss. Denn allein dadurch, dass wir hinblicken auf den Gleichgewichtszustand zwischen dem Schönen und dem Hässlichen, stehen wir in der Wirklichkeit darinnen, nicht einseitig in einer nicht zu uns gehörigen Wirklichkeit, die aber mit uns erstrebt wird, in der luziferischen, in der ahrimanischen Wirklichkeit.»3 Die Entscheidung zwischen den beiden Extremen Schönheit und Hässlichkeit ist also heute nicht das Zukunftsweisende im Kunstprozess, sondern die tätige Auseinandersetzung mit den beiden als Qualitäten des Luziferischen (ehemals schön) und des Ahrimanischen (ehemals hässlich) bezeichneten Extremen.
Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Website der Wochenschrift lesen.