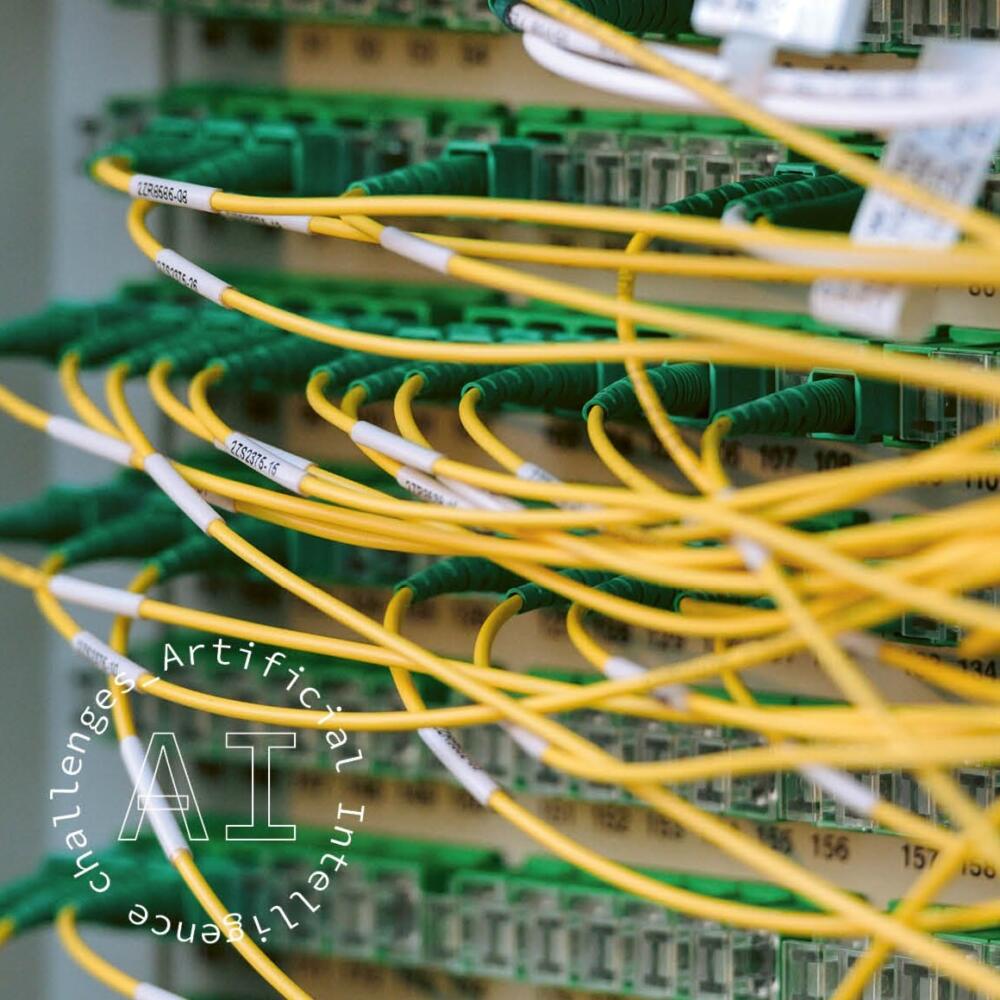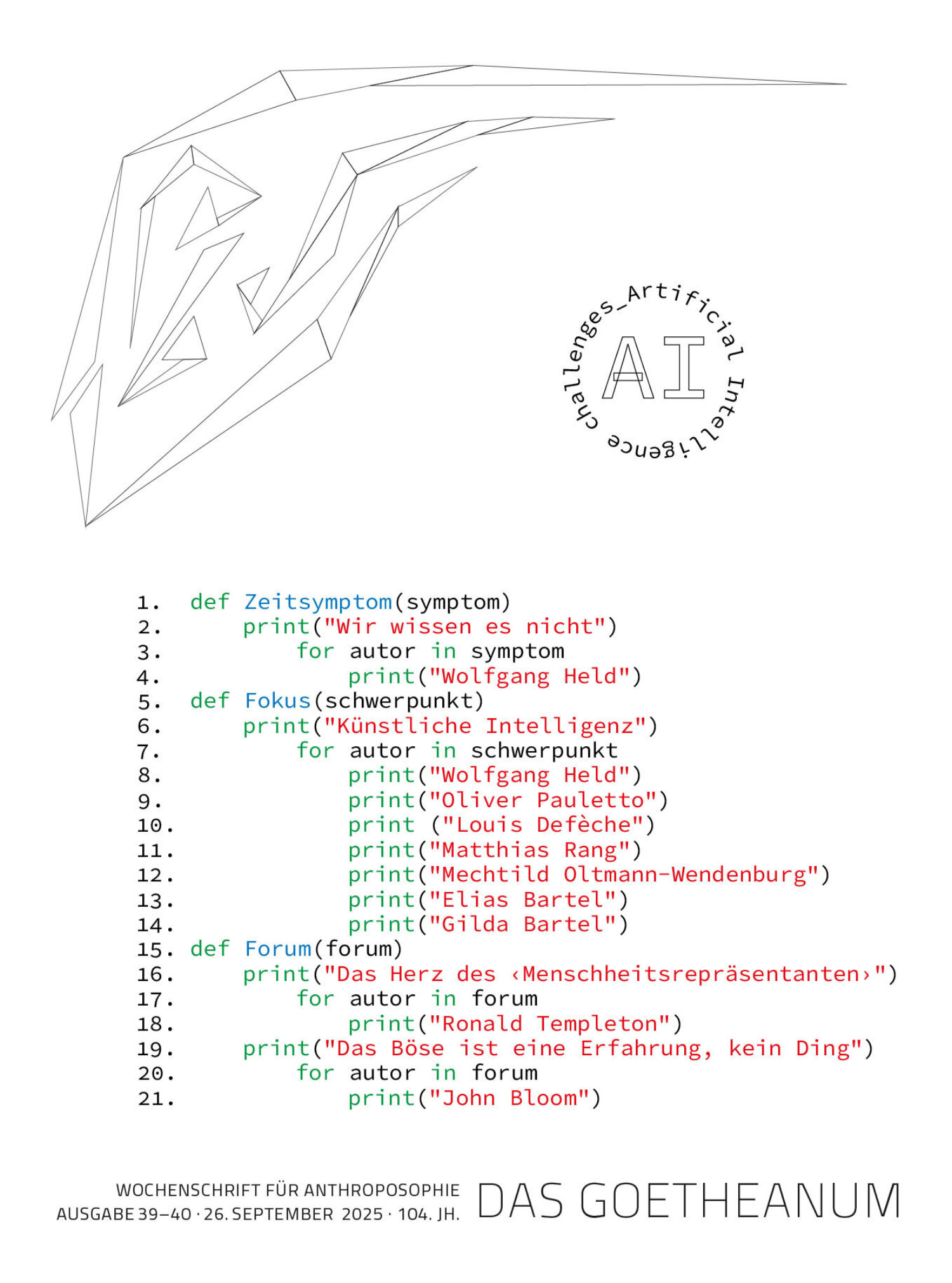Wenn die Vergangenheit in die Zukunft fortrollt
Was uns als Menschen ausweist, ist unser Körper. Über ihn erfahren wir die Wirklichkeit. KI hat keinen Körper und keinen geistigen Überorganismus, der – wie bei Lebewesen – deren Lebensräume verändern kann. Eine vergleichende Analyse aus naturwissenschaftlicher Sicht.
Es ist kein Trend der letzten Jahrzehnte, sondern der vergangenen Jahrhunderte, der uns Menschen zunehmend in einer Welt der Information leben lässt. Mit der Schrift ist eine Kulturtechnik entstanden, die es Menschen erlaubte, eine Welt, den ‹Korpus des Wissens›, zu schaffen. Schon lange ist dieser Korpus so groß, dass es in einer Lebensspanne vollkommen unmöglich ist, mehr als einen verschwindend kleinen Teil dieser gewaltigen Welt des Wissens und der Information zur Kenntnis zu nehmen. Dies berücksichtigend stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage wir uns für urteilsfähig halten. Aber nehmen wir an, wir könnten beispielsweise zu der Frage, wie ein Stein fällt, alle jemals verfassten Texte lesen, die Texte von Aristoteles, Abhandlungen der Scholastiker, der neuzeitlichen Vertreter der mechanischen Philosophie bis zu Galileo, Abhandlungen Newtons, die Mehrweltenquantentheorien und schließlich die Stringtheoretiker – würde uns dieses Wissen in Bezug auf die Frage urteilsfähig machen? Ich denke nicht. Letztlich ist es unsere Leiblichkeit und der durch sie mögliche Wirklichkeitsabgleich, in diesem Falle in Form des Experiments, der es uns erst ermöglicht, den Sinnzusammenhang all dieser Abhandlungen zu erschließen. Entkörperte Wesen können – ungeachtet ihrer Intelligenz – die Frage nicht fassen. Wann immer eine Frage unsere Welt betrifft, sei sie wissenschaftlich, kulturell oder politisch, so wird sie letztlich nicht im logischen Raum, sondern im Wirklichkeitsabgleich beantwortbar. Daher gründen die Naturwissenschaften nicht auf Wissen, sondern auf Erfahrung, die uns urteilsfähig macht.
Emanzipationsphänomene der Information
Doch ein Wirklichkeitsabgleich ist in der Flut der Informationen immer schwerer möglich. Die Globalisierung der Medienlandschaft – insbesondere durch digitale Medien – führt zunehmend dazu, dass die Lesenden einer Nachricht sich eingestehen müssen, nicht urteilsfähig zu sein, da ein Wirklichkeitsabgleich schon räumlich und zeitlich ausgeschlossen ist. Informationen sind heutzutage oft kaum nachprüfbar, sie ‹emanzipieren› sich aus den persönlichen Lebensbezügen. Als Physiker kenne ich das Phänomen, dass in riesigen Datenmengen sich nahezu jede Aussage finden und durch weitere Kontexte logisch stützen lässt, ohne dass klar ist, was sie mit der Wirklichkeit zu tun hat. Dem Aufpoppen von Faktenchecks, Begriffen wie ‹Fake News›, ‹alternative Fakten› liegt das implizite Eingeständnis zugrunde, dass ein Wirklichkeitsabgleich immer schwieriger wird. Diesen Trend setzt KI lediglich fort.
Sprachmodelle wie Chatgpt gehören zu den bemerkenswertesten, technischen Entwicklungen der letzten Jahre; sowohl die sprachliche als auch die inhaltliche Qualität der generierten Texte sind oft bewundernswert. Da ihnen allein der ‹Korpus des Wissens› zugrunde liegt, sie jedoch keinerlei direkten Wirklichkeitsbezug aufbauen können, kann man aber gerade an ihnen eindrücklich studieren, wie sich eine innere logische Struktur eines Textes vollständig emanzipiert davon, ob das Beschriebene einen Wirklichkeitsbezug aufweist oder kontrafaktisch ist, also realen Begebenheiten, wie historischen Ereignissen etc. widerspricht. Durch präzisere Trainingsmethoden gelang es den Entwicklern in den letzten Jahren, kontrafaktische Aussagen, die gerne auch als ‹Halluzinationen› bezeichnet werden, zu reduzieren. Jedoch frage ich mich, ob ihre Anwesenheit weniger als Problem der Programmierung der Sprachmodelle einzuordnen ist, als vielmehr als Charakteristikum eines gigantischen ‹Korpus des Wissens›, der sich in seinen Inhalten von der Wirklichkeit zunehmend zu emanzipieren beginnt. – Was uns im Augenblick überwiegend als vielleicht amüsante Fehlfunktion einer KI erscheint, droht dies nicht in Zukunft die neue Normalität einer mehr und mehr außerhalb der leiblichen Wahrnehmung lebenden Gesellschaft zu werden? Spiegelt uns die künstliche Intelligenz nicht Phänomene, die wir an uns selbst bereits studieren könnten? Aus dieser Perspektive erscheint die Sorge, dass KI-Systeme in Zukunft dem Menschen immer ähnlicher werden könnten, schon deshalb eher unbegründet, weil die Menschen der KI immer ähnlicher werden. Waldorfpädagogik und Goetheanismus in ihrer Zuwendung zur regelmäßigen und bewussten, sinnlichen und leiblichen Erfahrung erscheinen zunehmend als unverzichtbare, existenzielle Forderungen der Gegenwart.
Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Webseite der Wochenschrift lesen. Falls Sie noch kein Abonnent sind, können Sie die Wochenschrift für 1 CHF/€ kennenlernen.
Titelbild Glasfaser-Anschüsse in einem Serverraum. Foto: Albert Stoynov/Unsplash